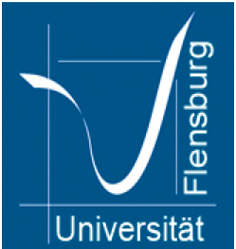Jedem Tag seine Krise
Im Alltag hat Aristoteles mit vielen Alten zu tun. In der Akademie Platons macht er Erfahrungen mit dem Altern und betagte Philosophen scheuen sich auch nicht, ganz offen darüber zu sprechen. Er nimmt ihre Gebrechen wahr und ist erstaunt über das fröhliche Jammern einiger angesehener weiser Denker. Er beobachtet bei den meisten der Alten mit dem Auftreten der Altersgüte und der damit verbundenen Gelassenheit einen großzügigeren Umgang mit Themen. Sie scheinen das Philosophieren als Einüben in das Sterben zu leben. Für seinen Lehrer Platon besteht ja auch die Bedeutung des Philosopierens darin, das Sterben zu lernen. Als Sohn des berühmten Arztes Nikomachos widerstreben Aristoteles solche Auffassungen. Schließlich ist er genug damit beschäftigt, in seinem Leben die häßliche Erscheinung durch seine Intelligenz, vornehme Kleidung und sorgfältigste Haarpflege zu überspielen. Zudem neigt er dazu, den Tod so zu nehmen, wie er sich dem Sezierenden zeigt. Angesichts der toten Körper kommen kaum Überlegungen in der Art Platons auf, nämlich, dass es sich ja schließlich nur um die Reste eines Hauses der Seele handeln soll. Nein, er hat genug damit zu tun, jeden Tag aufs Neue den schönen Schein von hoher Intelligenz und Begabung gegen sein Spiegelbild auszuspielen. Er ist nicht bereit nachzugeben, und so setzt er das Philosopieren nicht als Einüben im Sterben ein, sondern zur Sicherung des Lebens. Und auf seiner Suche, dem ständigen Schwund alles Seienden zu entgehen, entdeckt er das Sein, was sich ihm angesichts des überall ganz offensichtlichen Schwunds als das Bleibende offenbart.
wfschmid - 10. Mai, 15:32
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks