Spielen lernen
Begreifen, dass sich zweckfreies Verhalten insofern günstig auf die psychische Entwicklung auswirkt als die Neigung, geschlossene Strukturen zu bilden, durch das Interesse an offenen Strukturen kontrolliert wird.
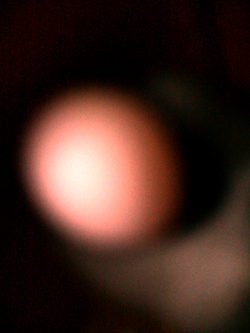
Spielen lernen vollzieht sich als Änderung des Verhaltens, indem sich dieses nicht nur in starren Mustern (Automatismen bzw. Routinen) ausprägt, sondern auch in frei verfügbaren Teilstrukturen (Funktionselemente). Das bedeutet, dass Spiel als Haltung der Bildentwicklung und der Begriffsbildung gegenüber aufzufassen ist und solche Spiele gemeint sind, welche diese Haltung unterstützen. Die Absicht zu gewinnen ergibt sich aus dem Bedürfnis, den Erfolg offenen Strukturierens zu erleben, ein Erlebnis des plötzlichen Spannungsabfalls ('Aha-Effekt'). Dieses Erleben wird bei der künstlerischen, philosophischen, mathematischen Tätigkeit immer wieder durch wider Erwarten auftretende Ergebnisse aufgebaut, das heißt, dass der Künstler, Philosoph oder Mathematiker sein Tun als spannend erlebt, ergibt sich aus der Erfahrung des jederzeit möglichen Neuen. Der Wissenschaftler spielt insofern mit künstlerischen, philosophischen oder mathematischen Metasystemen, als er diese unvoreingenommen in der Natur ausprobiert.
Wer spielen lernen will, um seine eigene Entwicklung günstig zu beeinflussen, muss sich auf das Spiel der Gedanken mit Bildern oder auf das (Rück)Spiel der Bilder mit Gedanken einlassen. Alle anderen Spiele kommen erst dann in Frage (und dies auch nur kurzfristig), wenn er sie zuvor erfindet. Jeder, der Spiele gern möglichst oft wiederholt, ist kein Spieler mehr, sondern ein Sportler. Wie dieser benötigt er Geräte: Geld, Klötze, Steine, Kugeln, Figuren, Würfel, da sich sein Wettkampf auf spielmustergesteuerte motorische Geschicklichkeiten beschränkt.
Die Konkurrenz verwandelt das Spiel in einen Kampf, aus dem freien Umgang mit den besten Möglichkeiten wird ein Ausnutzen jeder Möglichkeit, die Vorteile bringt.
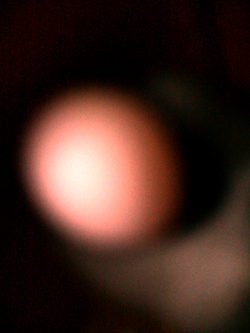
Spielen lernen vollzieht sich als Änderung des Verhaltens, indem sich dieses nicht nur in starren Mustern (Automatismen bzw. Routinen) ausprägt, sondern auch in frei verfügbaren Teilstrukturen (Funktionselemente). Das bedeutet, dass Spiel als Haltung der Bildentwicklung und der Begriffsbildung gegenüber aufzufassen ist und solche Spiele gemeint sind, welche diese Haltung unterstützen. Die Absicht zu gewinnen ergibt sich aus dem Bedürfnis, den Erfolg offenen Strukturierens zu erleben, ein Erlebnis des plötzlichen Spannungsabfalls ('Aha-Effekt'). Dieses Erleben wird bei der künstlerischen, philosophischen, mathematischen Tätigkeit immer wieder durch wider Erwarten auftretende Ergebnisse aufgebaut, das heißt, dass der Künstler, Philosoph oder Mathematiker sein Tun als spannend erlebt, ergibt sich aus der Erfahrung des jederzeit möglichen Neuen. Der Wissenschaftler spielt insofern mit künstlerischen, philosophischen oder mathematischen Metasystemen, als er diese unvoreingenommen in der Natur ausprobiert.
Wer spielen lernen will, um seine eigene Entwicklung günstig zu beeinflussen, muss sich auf das Spiel der Gedanken mit Bildern oder auf das (Rück)Spiel der Bilder mit Gedanken einlassen. Alle anderen Spiele kommen erst dann in Frage (und dies auch nur kurzfristig), wenn er sie zuvor erfindet. Jeder, der Spiele gern möglichst oft wiederholt, ist kein Spieler mehr, sondern ein Sportler. Wie dieser benötigt er Geräte: Geld, Klötze, Steine, Kugeln, Figuren, Würfel, da sich sein Wettkampf auf spielmustergesteuerte motorische Geschicklichkeiten beschränkt.
Die Konkurrenz verwandelt das Spiel in einen Kampf, aus dem freien Umgang mit den besten Möglichkeiten wird ein Ausnutzen jeder Möglichkeit, die Vorteile bringt.
wfschmid - 31. März, 06:33
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks


Trackback URL:
https://wolfgangschmid.twoday.net/stories/600628/modTrackback