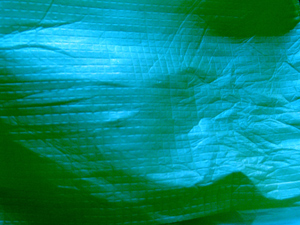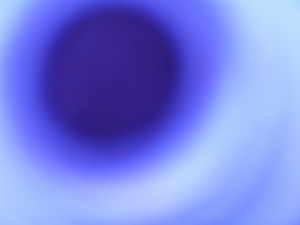Informationsverarbeitung - Interhemisphärischer Rhythmus
Sinne: wahrnehmen - Bedürfnis: sich Zeit nehmen, um zu betrachten - Vernunft: beobachten, sich einen Überblick verschaffen - Verstand: begreifen, sich ein Bild machen - Gefühl: entscheiden, was sich damit anfangen lässt. Das sieht als interhemisphärischer Rhythmus so aus:
{(L-R), (R), (L-R)), (L), (L-R)}

Es besteht weitgehend Einigung darüber, dass in unserer Gesellschaft zu viele Menschen zu linkslastig sind.
Wenn das aber der Fall ist, dann verkürzt sich aufgrund der Nichtbeteiligung der rechten Hemisphäre das Wahrnehmen auf bereits vorhandene Muster (Schubladen), dann fallen Betrachtungen sehr oft ganz aus, dann werden Beobachtungen eingeschränkt und durch Vorurteile beschleunigt, dann orientiert sich der Verstand nur noch an Vorhandenem, statt dieses zu verbessern oder gar Neues zu schaffen, dann verkümmert bewusstes Verhalten zu bloßen Reaktionen auf Aktionen von außen.
Zwischen dem Rhythmus interhemisphärischer Kommunikation und den unterschiedlichen Denkweisen besteht ein enger Zusammenhang.
So verkürzen streng lineares oder tabellarisches Denken den idealen 5/4-Takt bis auf den 2/4 Takt des Marschierens.
Zyklisches oder systemisches Denken dagegen folgt dem natürlichen idealen Takt, während modulares Denken den Rhythmus ständig wechselt.
Sobald es Lernende mit ‚Zwei-Wort-Gleichungen’, also mit tabellarischem Denken zu tun haben, erhöht sich die Anzahl der Wiederholungen drastisch. Ein Unterricht ohne Experimente oder Werkstattcharakter kann man sich unter dem Gesichtspunkt des Behaltens von Inhalten sparen.
{(L-R), (R), (L-R)), (L), (L-R)}

Es besteht weitgehend Einigung darüber, dass in unserer Gesellschaft zu viele Menschen zu linkslastig sind.
Wenn das aber der Fall ist, dann verkürzt sich aufgrund der Nichtbeteiligung der rechten Hemisphäre das Wahrnehmen auf bereits vorhandene Muster (Schubladen), dann fallen Betrachtungen sehr oft ganz aus, dann werden Beobachtungen eingeschränkt und durch Vorurteile beschleunigt, dann orientiert sich der Verstand nur noch an Vorhandenem, statt dieses zu verbessern oder gar Neues zu schaffen, dann verkümmert bewusstes Verhalten zu bloßen Reaktionen auf Aktionen von außen.
Zwischen dem Rhythmus interhemisphärischer Kommunikation und den unterschiedlichen Denkweisen besteht ein enger Zusammenhang.
So verkürzen streng lineares oder tabellarisches Denken den idealen 5/4-Takt bis auf den 2/4 Takt des Marschierens.
Zyklisches oder systemisches Denken dagegen folgt dem natürlichen idealen Takt, während modulares Denken den Rhythmus ständig wechselt.
Sobald es Lernende mit ‚Zwei-Wort-Gleichungen’, also mit tabellarischem Denken zu tun haben, erhöht sich die Anzahl der Wiederholungen drastisch. Ein Unterricht ohne Experimente oder Werkstattcharakter kann man sich unter dem Gesichtspunkt des Behaltens von Inhalten sparen.
wfschmid - 24. Februar, 06:25
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks