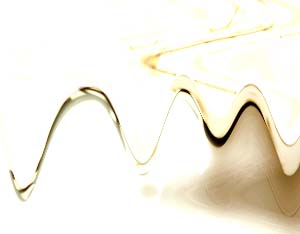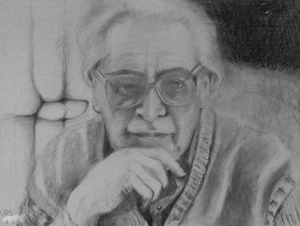Wir haben uns unmittelbar vor dem Museum verabredet. Es ist ein schöner Tag. Das Museum wird gleich geöffnet werden. Wir sind sehr neugierig auf das, was da wohl auf uns zukommen wird....

Jetzt werden wir eingelassen. Wir betreten die Eingangshalle. Wir brauchen nichts zu bezahlen, weil wir eingeladen worden sind. Wir durchqueren den Raum und gehen auf den Eingang der ersten Eingangshalle zu. Über dem Eingang ist auf einem Schild in schönen Buchstaben zu lesen: Halle des Lebenssinns...
Wir betreten diese Halle und finden darin lauter Kunstwerke, die sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigen. Da werden die körperlichen Bedürfnisse wie Schlaf, Hunger, Durst, Sexualtrieb dargestellt und ebenso die seelischen Bedürfnisse wie Freundschaft, Liebe, Glück, Erfolg oder die geistigen Bedürfnisse wie Ideale, Ideenreichtum, Werte...
Wir verlassen nun die Halle des Lebenssinns. Durch einen kurzen schmalen Gang gelangen wir in den Raum des Ichs. Der Raum des Ichs ist zu unserer großen Überraschung eine Art Spiegelkabinett. Aber wir werden nicht etwa verzerrt, sondern mit recht unterschiedlichem mimischen bzw. gestischen Ausdruck dargestellt.
Wir sehen uns ebenso erfreut oder überrascht wie verärgert oder erwartungsvoll. Zwischen diesen Spiegelungen (Reflexionen) hängen künstlerische Darstellungen von Szenen aus unserem Leben. An einem kleinen Tisch in einer Ecke des Raumes bietet eine freundliche Frau Videos an. Die Kassettenhüllen haben unterschiedliche Farben, aber keine Beschriftung. Wir fragen die Museumsangestellte, was auf den Videokassetten enthalten sei. Sie erklärt uns, dass es sich genau um jene Szenen aus unserem Leben handle, welche wir nie erzählen oder gar selbst nicht mehr wahrhaben wollen. Wir erkundigen uns, wer diese Aufnahmen gemacht hat. Die Frau lächelt und zuckt mit den Schultern um anzudeuten, dass sie das nicht weiss. Manche von uns überlegen kurz, ob sie eine dieser Kassetten oder gar alle mitnehmen sollen. Aber niemand getraut sich.
Im Verlauf unseres Museumsbesuchs kann ich allerdings beobachten, dass sich alle nach und nach möglichst unauffällig zu diesem kleinen Tisch begeben haben, um doch noch ein Video über einen bestimmten Ausschnitt aus ihrem Leben mitzunehmen. Schließlich gebe auch ich meiner Neugierde nach und gehe zu dem Videostand zurück. Ich werde gefragt, welcher Abschnitt in meinem Leben wohl der wichtigste sei.
Natürlich war es für mich zunächst einmal die eigene frühe Kindheit, weil ich über die kaum etwas weiss. Ich erkundige mich, ob es hier im Museum so etwas wie einen Videoraum gibt. Die Museumsangestellte bejaht das und erklärt mir den Weg dorthin. Ich bedanke mich, will aber zunächst mit den anderen den Museumsbesuch fortsetzen.
Wir streben allmählich dem Ausgang dieses Raumes zu, um nun in einem anderen Ausstellungsraum unseren Gang durch dieses ungewöhnliche Museum fortzusetzen. Kurz vor dem Ausgang wird auf einer Videowand mit dem Titel "Sprachlos" der nächste Kurzfilm angekündigt. Wir bleiben stehen, weil das erste Bild einen herrlichen Sonnenaufgang zeigt. Dann schwenkt die Kamera auf das Geländer eines Balkons, auf dem zwei Spatzen sitzen.
Frau Sperling: "Sie frühstücken wieder!"
Herr Sperling schaut seine Frau freudestrahlend an: "Sie machen wieder viele Krümel!"
Sie: "Hoffentlich gibt es keine spannenden Nachrichten!"
Er: "Warum?"
Sie schaut ihren Gatten etwas vorwurfsvoll an und erklärt ihm dann, dass doch das Tischtuch nur auf dem Balkon ausgeschüttelt wird, wenn sie während ihrer Zeitungslektüre nicht zu viel Kaffee verschütten.
Er: "Warum unterhalten sich die beiden nicht?"
Sie: "Sie brauchen sich nicht zu unterhalten. Sie haben abonnierte Worte. Da brauchen sie keine eigenen zu machen."
Er: "Ist Zeitunglesen schöner als ein gemeinsames Gespräch?"
Sie: "Spatzi, sie haben so früh morgens noch keine Worte füreinander!"
Er: "Aber abends reden sie auch nicht miteinander!"
Sie: "Da finden sie keine Worte mehr, weil sie zu müde sind. Sie sind so kaputt von ihrer Arbeit, dass sie nicht einmal mehr gekaufte Worte schaffen. Deshalb gucken sie nur noch Bilder."
Er: "Und wann unterhalten sie sich?"
Frau Sperling überlegt sehr lange und antwortet schließlich: "Oma Merle erzählte mir einmal, dass Menschen erst richtig miteinander reden, wenn einer von ihnen tot ist!"
Er: "Ist das, was sie Vernunft nennen?"
Sie: "Oma Merle jedenfalls erklärte mir das so: 'Lebewesen mit Vernunft können viel mehr sehen als wir mit unseren Augen; sie sehen Dinge, die überhaupt gar nicht da sind, jedenfalls für uns nicht. Nur für das Allerwichtigste sind sie vollkommen blind.' Oma Merle schwieg eine Weile und fügte dann hinzu: 'Sie können ihren Schöpfer nicht sehen'".
Herr Sperling: "Spatzmaus, guck', sie sind fertig mit Frühstücken... Achtung!... ....Sie kommt mit der Tischdecke!"...
Der Kurzfilm endet mit folgendem Nachspann: "Menschen können Sperlinge nicht verstehen, weil sie ihren Geist verloren haben und nur mit ihrer armseligen Vernunft zurecht kommen müssen. Weil der Empfang für sie zu schwach ist, vernehmen sie nur ein Gezwitscher."
Es folgt noch ein Nachtrag: "Meisen haben ihn London vor Jahren entdeckt, wie sich Milchflaschen ganz leicht öffnen lassen. Das haben sie den anderen mitgeteilt und innerhalb weniger Tage wussten alle Meisen in England, wie sie morgens ganz schnell an Milch kommen können. Heutzutage weiss jede Meise in jedem Land, das solche Milchflaschen noch hat, wie sich diese ganz schnell öffnen lassen."
Nun aber gehen wir auf die Ausgangstür zu, gelangen in einen schmalen Flur, der nach einer Weile im rechten Winkel nach links abbiegt.
Wir fragen einen Museumswärter, der auf uns zukommt, warum das Museum so eigenartig gebaut sei, was denn eigentlich diese schmalen Verbindungsflure für einen Sinn machen. Er erklärt uns, dass es sich um jene Ausstellungsräume handle, welche die Besucher selbst gestalten dürfen. Als er bemerkt, dass wir ihn nicht verstehen, lächelt er und flüstert uns zu, dass es sich um unsere Alltage handle, Zeiten, in denen wir uns gewöhnlich keine Gedanken über uns selbst machen. Wir schauen uns ebenso überrascht wie nachdenklich an. Etwas betroffen gehen wir auf den Eingang zum nächsten Raum zu. Wir lesen den Titel. Er lautet: Aufgaben.
Wir sind nicht wenig überrascht, als wir jene Aufgaben künstlerisch ins Werk gesetzt sehen, welche uns besonders wichtig erscheinen. Wir können sehen, dass wir Menschen und Dingen, die uns sehr viel bedeuten, viel zu wenig Beachtung schenken.
Auch in diesem Raum gibt es einen kleinen Tisch, auf dem CD-Roms zum Mitnehmen ausliegen. Als jemand eine CD einstecken will, kommt eine Mitarbeiterin des Museums auf uns zu, um uns darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesem Tisch um ein Kunstwerk handle. Peinlich. Tatsächlich hängt an der Wand unmittelbar hinter dem Tischchen ein kleines Schild mit der Aufschrift: "Versäumte Strategien - Installation aus Deiner wichtigsten Schaffensperiode" Unwillkürlich machen wir uns zwar über unsere Versäumnisse Gedanken, aber uns fallen auch sofort gute Ausreden ein. Und die meisten finden die sehr provokante Installation auch gar nicht sonderlich gut gelungen.
Wir sind alle sichtlich erleichtert, als wir das Hinweisschild zum nächsten Raum lesen. Da steht nur ein erlösendes Wort: "Bistro". "Vorsicht, Vorsicht!" sagt da jemand und fügt noch hinzu: "Es könnte sich ja auch um ein Kunstwerk handeln!" Wir gehen gespannt weiter. Der schmale Flur, der wiederum nach ein paar Schritten scharf im rechten Winkel nach links abbiegt, mündet aber tatsächlich in ein sehr nettes Café.
Dort treffen wir zu unserer großen Überraschung einen Menschen, den wir schon viele Jahre nicht mehr gesehen haben. Wir begrüßen uns herzlich. Wir erfahren, dass sich noch zwei weitere Leute, die wir von früher her kennen, im Museum aufhalten.
Wir fragen uns, warum wir gerade diese drei Menschen hier antreffen. Ist es Zufall oder haben sie auf besondere Weise mit unserem Leben zu tun?
Während wir noch diesen Gedanken nachhängen, betreten nun auch die beiden anderen das Bistro. Wir wollen unser Wiedersehen feiern und gemeinsam etwas unternehmen. Es ist eine für uns ungewöhnliche Unternehmung, und wir fragen uns, warum wir wohl gerade darauf gekommen sind und welcher Sinn dahintersteckt.
Nun, wir jedenfalls freuen uns darauf, bezahlen unsere Getränke, um das Bistro zu verlassen. Der Weg zum Ausgang des Museums führt durch den letzten Ausstellungsraum, der den Titel trägt "Deine Zukunft". Auch diesen Raum erreichen wir über einen schmalen Gang, der ebenfalls nach einigen Schritten im rechten Winkel nach links abbiegt.
Den letzten Ausstellungsraum finden wir alle sehr beeindruckend, weil wir uns dargestellt finden, wie wir in zehn, zwanzig, dreissig Jahren sein werden. Als wir nach einer Weile diesen Raum verlassen wollen, stellen wir fest, dass unsere Freunde von früher bereits vorausgegangen sind, vermutlich weil sie diese Ausstellungsräume schon kennen. Wir wollen sie nicht warten lassen und beeilen uns, um schnell über den schmalen Verbindungsflur in den Raum des Ichs zu gelangen. Diesen durchqueren wir, um über den Raum des Lebenssinns das Museum zu verlassen.
Völlig überrascht sind wir, als auch vor dem Museum niemand auf uns wartet. Statt dessen werden Prospekte verteilt. Darauf können wir lesen: "Gib auf dich acht, damit du nicht eines Tages traurig den Menschen grüssen musst, der du hättest sein können!"