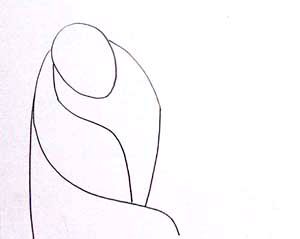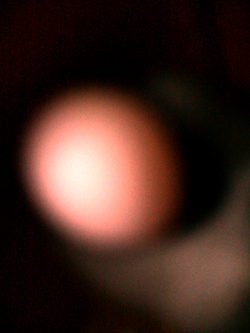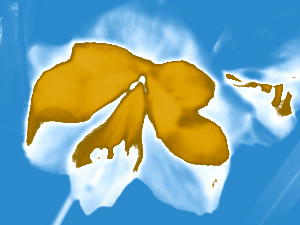Werden VI
Nirvana als mögliche Erfahrung setzt die Anerkennung der Nichtigkeit des Ichs und die Erkenntnis voraus, dass der Alltag von einer krampfhaften Fixiertheit auf das Ich bestimmt ist. Es kommt alles darauf an, sich aus dieser Fixiertheit zu befreien.

Metaphysik dagegen hebt das Ich als Subjekt des Denkens hervor und versucht dieses in seinem Denken zu erfassen. Das westliche Denken ist immer ein Ich-Denken. Das östliche Denken ist dagegen immer ein Nicht-Ich-Denken. Das östliche Denken ist der unentwegte Versuch, in den Abstand zu sich selbst zu gelangen, um das Ich in seiner Nichtigkeit zu schauen. Die Befreiung aus der Ich-Haft ist das wesentliche Anliegen östlicher Philosophie.
Nirvana vollzieht sich als das Irrelevantwerden von Gegensätzen. Metaphysik aber ist von ihrem Grund her auf Gegensätzen aufgebaut, vor allem auf dem Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt. Das östliche Denken verneint diese Gegensätzlichkeit nicht, sondern erfasst sie als Beleg für die Brüchigkeit des Ichs. Aus der Einsicht in die Leere von allem erwächst die Verbundenheit mit allem. Das Aushalten von Leere bedeutet Freiheit, wenn sie nicht mehr auf dem Hintergrund der Sehnsucht nach Sicherheit ausgelegt wird. Wenn die Vernunft nicht mehr anhaftet und alles ergreift, erwacht der Mensch zur Weisheit (Prajna), mit der alle Menschen geboren werden.
Der Philosoph Arthur Schopenhauer versucht die östliche und westliche Philosophie zu verbinden und kommt zu einer umfassenden Philosophie des Mitleids. Die Grenzen einer Welt, die im Grunde durch den Willen, den Drang zur Selbststeigerung und Machtvergrößerung, geprägt ist, werden überschritten.
Sowohl Maurice Merleau-Ponty als auch Martin Heidegger nehmen Bezug auf östliches Denken, ihre Philosophie wird dementsprechend häufig im Lichte der östlichen Philosophie bzw. des Zen-Buddhismus interpretiert.

Metaphysik dagegen hebt das Ich als Subjekt des Denkens hervor und versucht dieses in seinem Denken zu erfassen. Das westliche Denken ist immer ein Ich-Denken. Das östliche Denken ist dagegen immer ein Nicht-Ich-Denken. Das östliche Denken ist der unentwegte Versuch, in den Abstand zu sich selbst zu gelangen, um das Ich in seiner Nichtigkeit zu schauen. Die Befreiung aus der Ich-Haft ist das wesentliche Anliegen östlicher Philosophie.
Nirvana vollzieht sich als das Irrelevantwerden von Gegensätzen. Metaphysik aber ist von ihrem Grund her auf Gegensätzen aufgebaut, vor allem auf dem Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt. Das östliche Denken verneint diese Gegensätzlichkeit nicht, sondern erfasst sie als Beleg für die Brüchigkeit des Ichs. Aus der Einsicht in die Leere von allem erwächst die Verbundenheit mit allem. Das Aushalten von Leere bedeutet Freiheit, wenn sie nicht mehr auf dem Hintergrund der Sehnsucht nach Sicherheit ausgelegt wird. Wenn die Vernunft nicht mehr anhaftet und alles ergreift, erwacht der Mensch zur Weisheit (Prajna), mit der alle Menschen geboren werden.
Der Philosoph Arthur Schopenhauer versucht die östliche und westliche Philosophie zu verbinden und kommt zu einer umfassenden Philosophie des Mitleids. Die Grenzen einer Welt, die im Grunde durch den Willen, den Drang zur Selbststeigerung und Machtvergrößerung, geprägt ist, werden überschritten.
Sowohl Maurice Merleau-Ponty als auch Martin Heidegger nehmen Bezug auf östliches Denken, ihre Philosophie wird dementsprechend häufig im Lichte der östlichen Philosophie bzw. des Zen-Buddhismus interpretiert.
wfschmid - 7. April, 06:11
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks