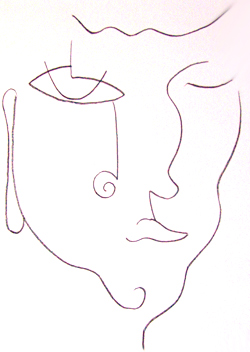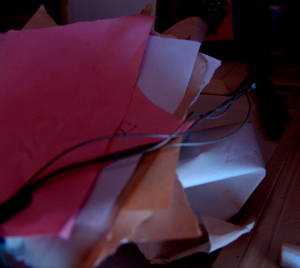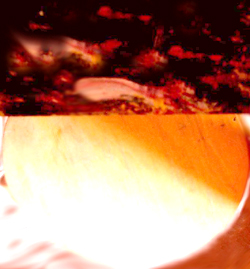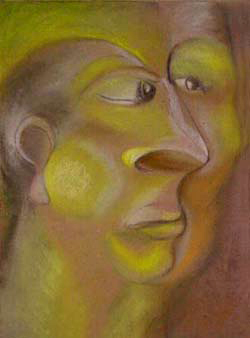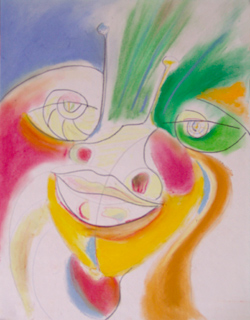Der Übergang vom Mythos zum Logos - Vom Wahrnehmen zum Begreifen IV
Unsere Wahrnehmung wird vor allem durch unser Weltmodell bestimmt wird. So geht zwar die Metaphysik gar auf das Sein im Ganzen zu, aber gerade durch diesen Zugang verbaut sie dem Philosophierenden eine ganzheitliche Sicht.

Unvermeidbare Übungen in der Abstraktion gehen zu Lasten der Erfahrung im Konkretisieren. Die allmählich wachsende Vertrautheit im Umgang mit dem 'Ganzen' reduziert das Gefühl für das Einzelne.
Wir Menschen lernen nur aus Bildern, die uns unsere sinnlichen Erfahrungen im Bewußtsein gestalten. Diese Erfahrungsbilder werden zunehmend mehr durch Begriffe ersetzt, also durch Muster, nach denen unsere Wahrnehmungen strukturiert werden. Indem wir in die Lage versetzt werden, trennscharf zu beobachten, wird für uns das unvoreingenommene (ganzheitliche) Betrachten immer fremder. Diese Art von Selbstentfremdung läßt uns das Gespür für das Besinnliche verlieren. Indem wir zunehmend von Begriffen abhängig werden, die nicht auf natürliche Weise in uns gewachsen sind, schwindet in uns das Selbstwertgefühl. Der oft beklagte Werte-Verlust unserer Zeit ist auch eine natürliche Folge der Entsinnlichung unserer Erfahrung. An die Stelle
des Sinns tritt die Funktion. Dasein wandelt sich zum fremdbestimmten Sosein. Dieser Wandel erfährt zwar gegenwärtig eine high-tec-bedingte Beschleunigung, aber angelegt ist diese Entwicklung bereits in den Anfängen Abendländischer Kultur.
Indem die Metaphysik den Blick für das Wesentliche beansprucht, verliert sie das Verständnis für das, was den Menschen eigentlich bestimmt: die besonderen Merkmale seiner Persönlichkeit. Sogenannte Wesensbegriffe - die Pädagogik ist voll davon - helfen dem Menschen nicht weiter, weil sie ihn formelhaft auf ein Sein reduzieren, das ihm in den konkreten Situationen seines Daseins niemals begegnet. Wenn wir unsere Wahrnehmungsfähigkeit wieder zurückgewinnen wollen, dann sollten wir damit beginnen, unsere erziehungsbedingten Wahrnehmungsfilter abzubauen und aufhören, so zu tun, als seien diese naturgegeben und deshalb unüberwindbar. Andererseits müssen wir bedenken, dass die ganzheitliche Sicht - die Einsicht etwas bleibt - uns ziemlich selten gelingen wird. Das läßt sich leicht erklären: Würden wir uns selbst ständig mit Einsicht begegnen, könnten wir vieles von dem, was wir treiben, nicht mehr tun. Dennoch: die EINsicht bleibt eine positive Utopie unseres Alltags, eine Kraft, die uns antreibt, unsere eigenen Grenzen möglichst weit zu verschieben, damit unser Handlungsspielraum wächst.

Unvermeidbare Übungen in der Abstraktion gehen zu Lasten der Erfahrung im Konkretisieren. Die allmählich wachsende Vertrautheit im Umgang mit dem 'Ganzen' reduziert das Gefühl für das Einzelne.
Wir Menschen lernen nur aus Bildern, die uns unsere sinnlichen Erfahrungen im Bewußtsein gestalten. Diese Erfahrungsbilder werden zunehmend mehr durch Begriffe ersetzt, also durch Muster, nach denen unsere Wahrnehmungen strukturiert werden. Indem wir in die Lage versetzt werden, trennscharf zu beobachten, wird für uns das unvoreingenommene (ganzheitliche) Betrachten immer fremder. Diese Art von Selbstentfremdung läßt uns das Gespür für das Besinnliche verlieren. Indem wir zunehmend von Begriffen abhängig werden, die nicht auf natürliche Weise in uns gewachsen sind, schwindet in uns das Selbstwertgefühl. Der oft beklagte Werte-Verlust unserer Zeit ist auch eine natürliche Folge der Entsinnlichung unserer Erfahrung. An die Stelle
des Sinns tritt die Funktion. Dasein wandelt sich zum fremdbestimmten Sosein. Dieser Wandel erfährt zwar gegenwärtig eine high-tec-bedingte Beschleunigung, aber angelegt ist diese Entwicklung bereits in den Anfängen Abendländischer Kultur.
Indem die Metaphysik den Blick für das Wesentliche beansprucht, verliert sie das Verständnis für das, was den Menschen eigentlich bestimmt: die besonderen Merkmale seiner Persönlichkeit. Sogenannte Wesensbegriffe - die Pädagogik ist voll davon - helfen dem Menschen nicht weiter, weil sie ihn formelhaft auf ein Sein reduzieren, das ihm in den konkreten Situationen seines Daseins niemals begegnet. Wenn wir unsere Wahrnehmungsfähigkeit wieder zurückgewinnen wollen, dann sollten wir damit beginnen, unsere erziehungsbedingten Wahrnehmungsfilter abzubauen und aufhören, so zu tun, als seien diese naturgegeben und deshalb unüberwindbar. Andererseits müssen wir bedenken, dass die ganzheitliche Sicht - die Einsicht etwas bleibt - uns ziemlich selten gelingen wird. Das läßt sich leicht erklären: Würden wir uns selbst ständig mit Einsicht begegnen, könnten wir vieles von dem, was wir treiben, nicht mehr tun. Dennoch: die EINsicht bleibt eine positive Utopie unseres Alltags, eine Kraft, die uns antreibt, unsere eigenen Grenzen möglichst weit zu verschieben, damit unser Handlungsspielraum wächst.
wfschmid - 5. Mai, 06:38
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks