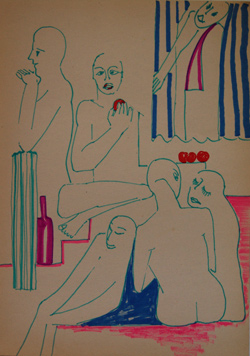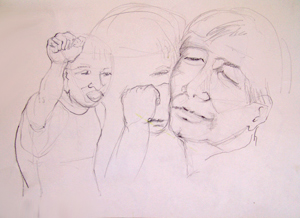Gedanken sind Aufforderungen
Denken geschieht als Bilderleben. Und Zoomen ist eine Weise mit Bildern zu spielen.
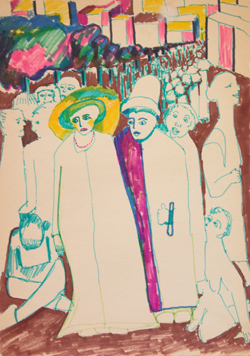
Denken ist das Spielen mit Bildern in unserer Vorstellung. Die Philosophie schenkt uns die Möglichkeit, dieses Spiel immer besser zu beherrschen und so mit Bildern zu spielen, dass sie sich zu schöpferischem Gestalten vereinigen.
Das Spiel mit Bildern, das Bilder-Leben und das Bild-Erleben also, muss behutsam erweitert werden, wenn es sich entwickeln können soll.
Wir haben das Zoomen, die Nähe und Ferne zu Bildern in unserer Vorstellung, vergegenwärtigt. Die Beschreibung des Zoomens als Annähern und Entfernen reicht zwar für das geistige Wahrnehmen und Betrachten aus, aber sie lässt noch keine geregeltes Überführen in Beobachten zu.
Die Schwierigkeiten, solche Überführungen zu leisten, ergeben sich vor allem aus der Sprache. Worte bleiben weit hinter dem zurück, was Bilder zeigen. Die Aufforderung, einen Grashalm zu zoomen, vermag nur anzugeben, was mit dem Bild getan werden soll. Über den Inhalt des Bildes wird nichts ausgesagt. Der Inhalt wird lediglich beim Namen genannt.
Zur Sprache gebrachtes Denken vermag nicht mehr widerzuspiegeln als das, was mit etwas zu tun ist. Eine klare Aufforderung, mit etwas Bestimmten etwas Bestimmtes zu tun, heisst Gedanke. Zoomen ist ein solcher Gedanke.
Alle Sätze, die zu einem Tun auffordern, enthalten folglich Gedanken. Beispiel: Nehmen Sie den Grashalm wahr. Betrachten Sie ihn. Beobachten Sie ihn...
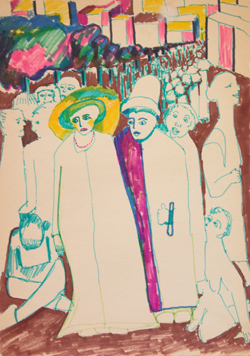
Denken ist das Spielen mit Bildern in unserer Vorstellung. Die Philosophie schenkt uns die Möglichkeit, dieses Spiel immer besser zu beherrschen und so mit Bildern zu spielen, dass sie sich zu schöpferischem Gestalten vereinigen.
Das Spiel mit Bildern, das Bilder-Leben und das Bild-Erleben also, muss behutsam erweitert werden, wenn es sich entwickeln können soll.
Wir haben das Zoomen, die Nähe und Ferne zu Bildern in unserer Vorstellung, vergegenwärtigt. Die Beschreibung des Zoomens als Annähern und Entfernen reicht zwar für das geistige Wahrnehmen und Betrachten aus, aber sie lässt noch keine geregeltes Überführen in Beobachten zu.
Die Schwierigkeiten, solche Überführungen zu leisten, ergeben sich vor allem aus der Sprache. Worte bleiben weit hinter dem zurück, was Bilder zeigen. Die Aufforderung, einen Grashalm zu zoomen, vermag nur anzugeben, was mit dem Bild getan werden soll. Über den Inhalt des Bildes wird nichts ausgesagt. Der Inhalt wird lediglich beim Namen genannt.
Zur Sprache gebrachtes Denken vermag nicht mehr widerzuspiegeln als das, was mit etwas zu tun ist. Eine klare Aufforderung, mit etwas Bestimmten etwas Bestimmtes zu tun, heisst Gedanke. Zoomen ist ein solcher Gedanke.
Alle Sätze, die zu einem Tun auffordern, enthalten folglich Gedanken. Beispiel: Nehmen Sie den Grashalm wahr. Betrachten Sie ihn. Beobachten Sie ihn...
wfschmid - 2. Juni, 06:16
2 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks