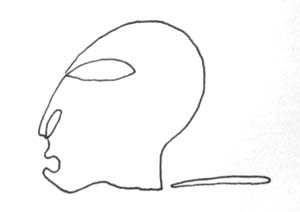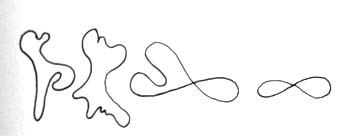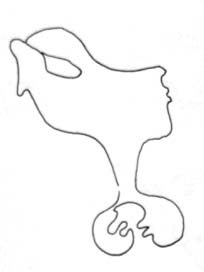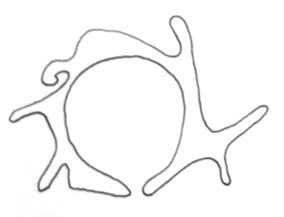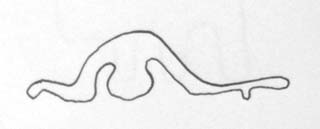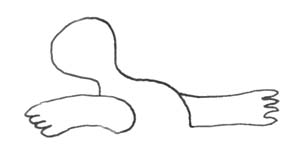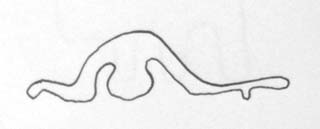
In seinem Werk "Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben" schreibt der Philosoph Friedrich Nietzsche: "...wir sind zum Leben, zum richtigen und einfachen Sehen und Hören, zum glücklichen Ergreifen des Nächsten und Natürlichen verdorben und haben bis jetzt noch nicht einmal das Fundament einer Kultur, weil wir selbst nicht davon überzeugt sind, ein wahrhaftiges Leben in uns zu haben." Kurzum: Wir haben das Gespür für das Leben verloren!
Nietzsche erklärt auch den zureichenden Grund für unser unnatürliches Verhalten: "Zerbröckelt und auseinandergefallen, im ganzen in ein Äußeres und ein Inneres halb mechanisch zerlegt, mit Begriffen wie mit Drachenzähnen übersät, Begriffsdrachen erzeugend, dazu an der Krankheit der Worte leidend und ohne Vertrauen zur eigenen Empfindung, die noch nicht mit Worten abgestempelt ist: als eine solche unlebendige und doch unheimlich regsame Begriffs- und Worte-Fabrik habe ich vielleicht noch das Recht, von mir zu sagen cogiti, ergo sum, nicht aber vivo, ergo cogito. Das leere 'Sein', nicht das volle und grüne 'Leben' ist mir gegegeben."
Und im 'Versuch einer Selbstkritik' zur 'Die Geburt der Tragödie' (1886) beschreibt Nietzsche den entscheidendenden Aspekt, unter welchem "sich jenes verwegene Buch zum ersten Male herangewagt hat, - die Wissenschaft unter der Optik des Künstlers zu sehn, die Kunst aber unter der des Lebens..."
Ein Rückgang in die Anfänge der abendländischen Kultur zeigt, dass dieser Zusammenhang in den Anfängen bereits gedacht worden war, denn nicht von ungefähr gaben die Griechen der Kunst des Wahrnehmens und Lernens den Namen "mathematiké téchne": Mathematik. Bis heute ist die Mathematik jene Geisteswissenschaft geblieben, welche Abstraktion und Konkretion bzw. Theorie und Praxis einer Anwendung in sich vereint. Die Schwierigkeit (höhere) Mathematik zu verstehen, besteht vor allem darin, dass sie philosophisch gedacht und künstlerisch angewendet werden muss. Wer mathematisches Denken im Unterricht nicht über Anschauungen initiert, kann von Lernenden nicht erwarten, dass sie mathematisch verstehen.
Kunst, Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften spielen ständig mit dem Wechsel von Möglichkeit und Wirklichkeit bzw. Theorie und Praxis. Diese Spiel kennt nur Entscheidungen zwischen einem eindeutigen Ja oder einem ebenso klaren Nein. Unser Gehirn kommt deshalb mit diesem Spiel am besten zurecht, weil es zu seinen neuronalen Regeln und Strategien kongruent ist. Mit allen anderen Vorgehensweisen bekommt das Gehirn natürlicherweise Schwierigkeiten.
Wir wollen uns einmal ein Fach ansehen, das die natürlichen Spielregeln des Gehirns am wenigstens beherrscht. Interessant dabei ist, dass dieses Fach für sich beansprucht, junge Menschen zu Lehrern auszubilden. Schauen wir uns das einmal an einem Fall an.
Studierende, die sich auf das Unterrichten vorbereiten, werden beinahe in allen vorbereitenden Veranstaltungen mit der Planung ihres Unterrichts vertraut gemacht. Es werden sogenannte Planungspapiere verteilt, die Studierende bei ihrer Vorbereitung auf den Unterricht unterstützen sollen, und zwar unabhängig vom einzelnen Fach und der zu erwartenden Gruppe der Lernenden.
Dieses Planungspapier, das auch noch im Referendariat eingesetzt und gefordert wird, ist eine Excel-Tabelle. Diese Tabelle weist gewöhnlich in etwa folgende Zeilen auf: 1. Kontrolle der Hausaufgaben, 2. Einführung, Hinführung oder Einstieg, 3. Information, 4. Übung oder Experiment, 5. Auswertung, 6. Hausaufgaben. Die Bezeichnungen der Spalten können zwar andere sein, aber inhaltlich fordern sie einen vergleichbaren Vorgang. Die Spalten dieses Planungsrasters werden wie folgt bezeichnet: 1. Zeit, 2. Lehrerverhalten, 3. Schülerverhalten, 4. Sozial- oder Unterrichtsform, 5. Medieneinsatz. Auch hier können die Bezeichnungen je nach Geschmack der Lehrenden wiederum abweichen. Vereinfachend wird diese kleine Tabelle "Unterrichtsverlaufsskizze" genannt.
Wird nun der Ablauf einer Unterrichtstunde nach dieser Unterrichtsverlaufsskizze überprüft, dann geschieht es sehr oft, insbesondere bei Anfängern, dass das unterrichtliche Geschehen für gut befunden wird. Schließlich ist ja alles so verlaufen, wie es vorgesehen war, vorausgesetzt, die Lernenden haben dabei nicht nennenswert gestört.
Aber ganz im Gegensatz zur angenommenen Unterrichtsverlaufsskizze kann der Unterricht fachlich voller Fehler sein. Das ist sogar gewöhnlich so, weil eine inhaltliche Betreuung außerhalb der Fachpraktika und Mentorengepräche nicht stattfindet. Es geht nicht um d e n fehlerfreien Unterricht, sondern um einen Unterricht, der von Anfang an fachlich fehlerhaft organisiert wird. Es liegt in der Natur der Sache, dass fachliche Fehlentscheidungen kaum in Sportstunden auftreten oder in Stunden, in denen es um handwerkliche Geschicklichkeits- oder Bestimmungsübungen geht.
Was läuft denn so schief bei der Handhabung der üblichen Unterrichtsverlaufsskizze?
(swf)