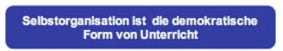Aber dass wir nicht allein schuld sind, sondern auch unser Gehirn ein gutes Stück dazu beiträgt, soll folgendes Beispiel beweisen. So bevorzugt unser Gehirn das, was ihm wichtiger erscheint und passt dann das Übrige schlichtweg an.
Sehen Sie bitte hierfür die Beispiele der Illusionen unter Focus-online an:
Focus online, Illusionen (1)
So erscheinen die beiden Geraden im Poggendorff-Experiment (a.a.O.) nicht mehr parallel, weil die rechte Gerade unter dem Einfluss des Rechtecks mehr geneigt zu sein scheint.
Erst durch Wegnahme des Rechtecks wird das Trugbild offensichtlich.
Viele setzen bei diesem Experiment die Linien zu hoch an. Eine Erklärung für diese Illusion scheint zu sein, dass das Gehirn die Winkel missinterpretiert, in dem die Teilstrecken das Rechteck schneiden.
Unser Gehirn versucht die Teilobjekte (Rechteck und Teilgeraden) eindeutig voneinander zu trennen und erhöht dabei die Winkel zwischen den Teilgeraden und dem Rechteck (gegen 90 Grad). Nach-dem unser Gehirn die Winkel erhöht hat, können wir die beiden Linien nicht mehr richtig ausrichten.
Wählen Sie ein anderes (schmaleres) Rechteck und Sie werden sehen, dass es Ihnen nun leichter fällt.
Das Experiment trägt den Namen von Johann Poggendorff (1796-1877), einem deutschen Physiker, der das Phänomen 1860 erstmals beschrieb.
Das Beispiel zeigt, dass Wahrnehmungen nicht nur durch Vorurteile, sondern ebenso durch optische Täuschungen verstellt werden können, ein Sachverhalt, auf den bereits René Descartes aufmerksam macht, wenn er feststellt, dass ein gerader Stab, den man ins Wasser hält, gebrochen erscheinen wird. Der Stock ist an sich gerade, er wird jedoch gebrochen wahrgenommen.
"Seit vier Jahrhunderten zerbrechen sich Wissenschaftler den Kopf über die Frage, was passiert, wenn Licht an einer Grenzfläche zweier transparenter Materialien gebrochen wird. Willebrord Snellius (1580-1626), René Descartes (1596-1650), Isaac Newton (1643-1727) und Johann Wolfgang von Goethe (1749-1823) haben sich hierzu geäußert. Das Snelliussche Brechungsgesetz – in Frankreich übrigens als das Brechungsgesetz von Descartes bekannt – lernt heute jedes Kind in der Schule: Das Licht wird von Vakuum oder Luft her kommend im Material mit Brechzahl n > 1 zum Lot hin gebrochen."
Quelle des Zitats:
digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/documents/754585
__
(1) Quelle:
http://www.focus.de/wissen/bildung/illusionen/nichts-ist-wie-es-scheint_aid_23169.html
Es gelten die AGB von TOMORROW FOCUS MEDIA GmbH im Rahmen von Online-focus.de